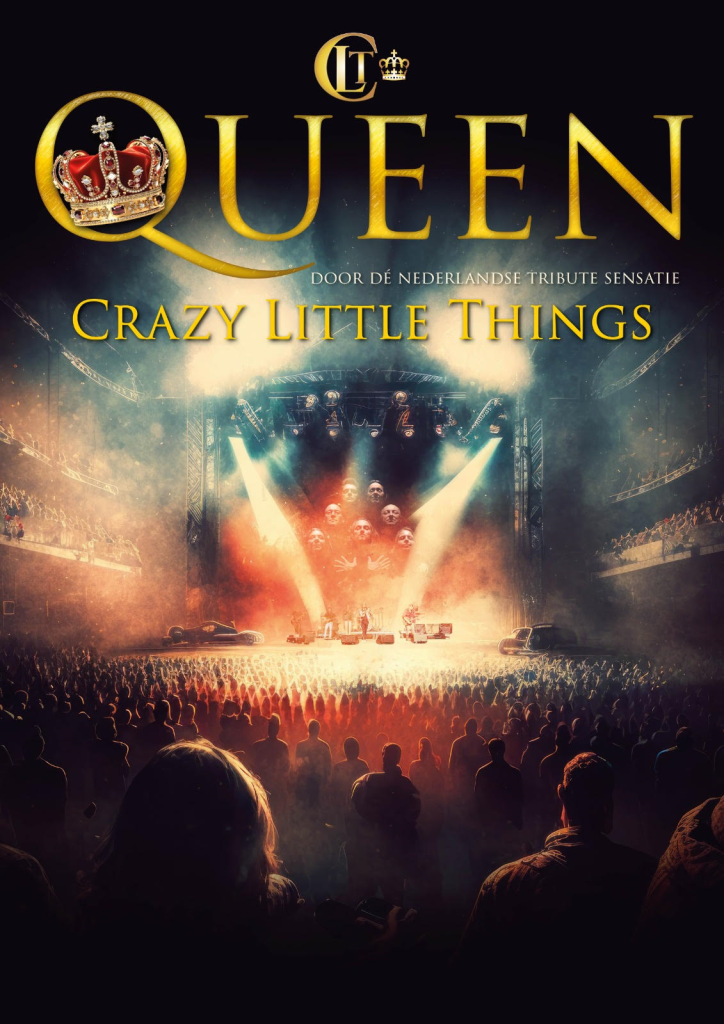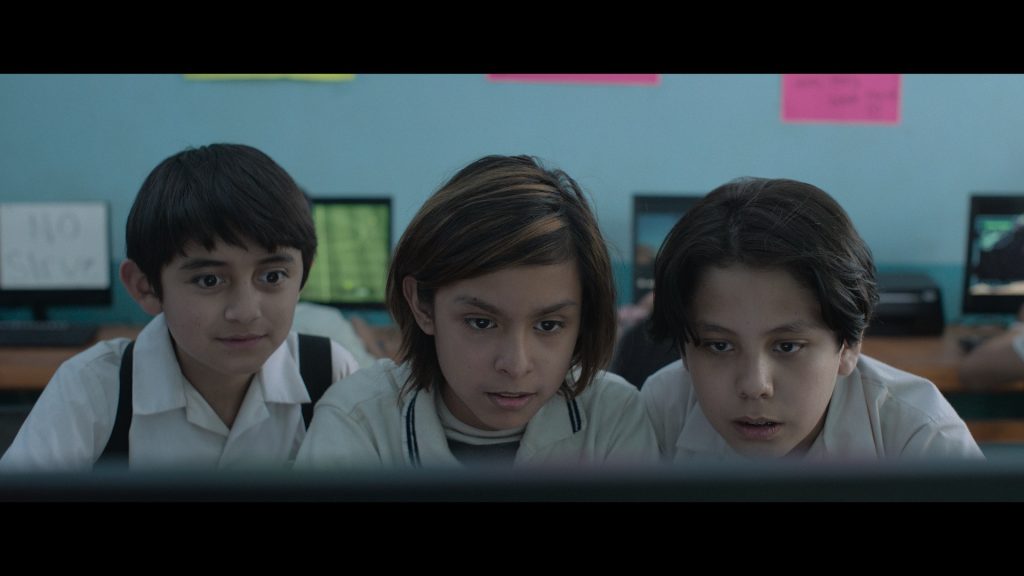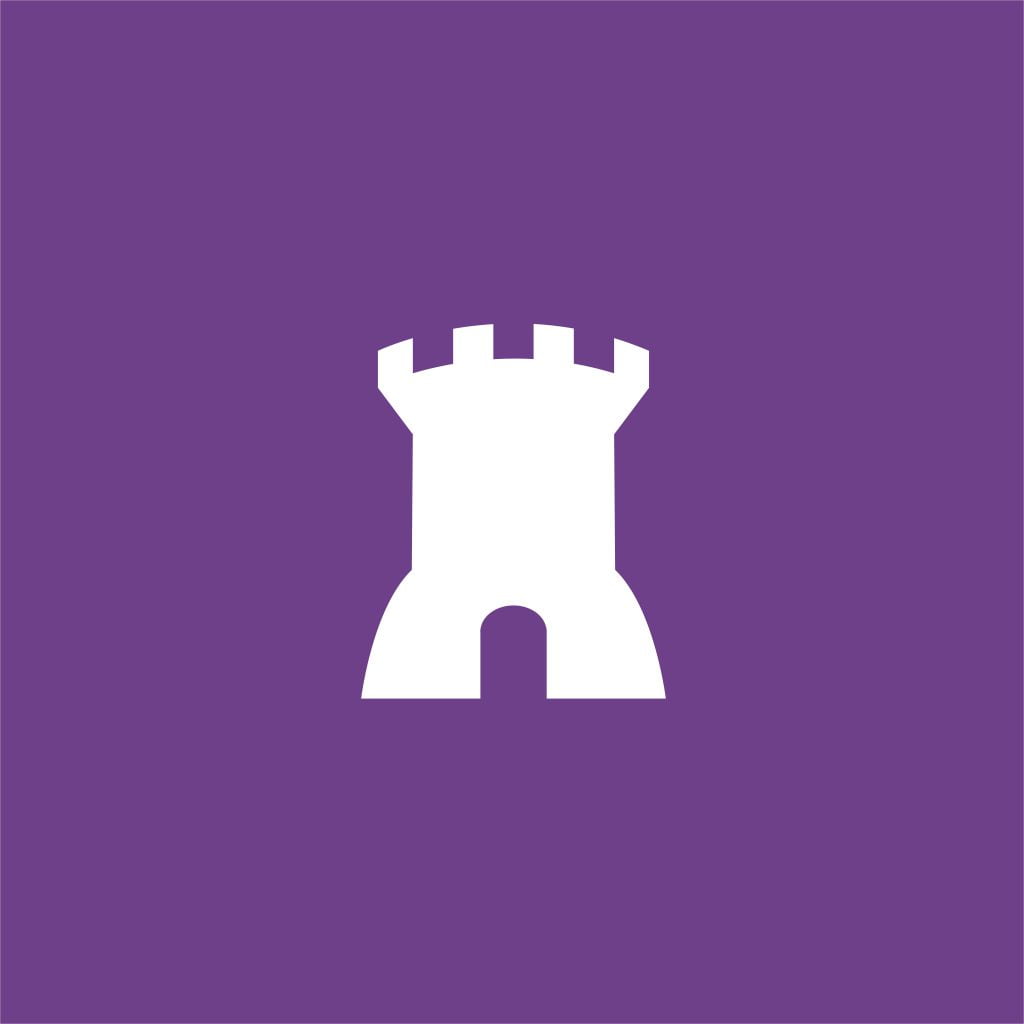Welkom in Halderberge
Geniet van onze prachtige natuur, het bijzondere erfgoed of laat het je smaken in één van de vele knusse restaurants of cafés
Arrangementen
Om jou te ontzorgen hebben we speciale arrangementen samengesteld voor een compleet dagje uit in Halderberge. Of je nu op zoek bent naar een luncharrangement, een stadswandeling met koffie en gebak of een combinatie van activiteiten, wij hebben het voor je geregeld in een arrangement.
Combineer je bezoek met een heerlijke lunch in een gezellig restaurant. Geniet van lokale gerechten en laat je verwennen door de Brabantse gastvrijheid in Halderberge.
Kortom, er zijn talloze mogelijkheden om je bezoek aan de gemeente Halderberge compleet te maken. Kies het arrangement dat bij jou past en bestel je tickets. Geniet van een onvergetelijke dag vol ontspanning, cultuur en culinaire hoogstandjes in de gemeente Halderberge.
Ontdek klein Rome in Brabant
Stadswandeling & audiotour Basiliek
11:00 – 12:30 uur Stadswandeling Oudenbosch
12:30 – 13:30 uur Lunch bij Villa d’este
13:30 – 14:30 uur Audiotour Basiliek
14:30 – 15:00 uur Afsluiting met koffie en gebak bij un Momento
Dit arrangement is te boeken vanaf 8 personen woensdag t/m zondag voor €25,95 p.p.Vliegensvlug door Halderberge
13:00 - 14:00 uur Bezoek Vliegend Museum inclusief rondleiding
14:00 - 14:30 uur vertrek naar Oudenbosch (5,5 km)
14:30 - 15:30 uur Koffie met gebak bij un Momento
15:30 - 16:30 uur Audiotour of rondleiding Basiliek
Dit arrangement is te boeken op zaterdag en zondag voor €29,50 per persoon
Uitgelichte evenementen
Ontdek welke evenementen er tijdens je verblijf in Halderberge en de regio plaatsvinden. Concerten, exposities, en meer!
Startdatum: 1-4-2024
Einddatum: 31-12-2024
Startdatum: 11-5-2024
Einddatum: 23-5-2024

De highlights van Halderberge
Wat je niet mag missen als je in Halderberge bent
De 5 Halderbergse dorpen
Halderberge is een gemeente in West-Brabant die bestaat uit 5 dorpen. Oudenbosch, Oud Gastel, Hoeven, Bosschenhoofd en Stampersgat.
Klik op de dorpen hier onder en ontdek meer.